Wie viele Bücher lese ich eigentlich in einem Jahr? Und was kommt da alles zusammen? Das wollte ich schon lange mal festhalten, also fange ich heute damit an. Außerdem ist Herbst und damit beste Lesezeit. Aus praktischen Gründen gibt es einmal im Monat eine Übersicht, sonst wird dies einer von diesen Endlos-Scrolling-Beiträgen, die niemand lesen mag.
29.9.2016
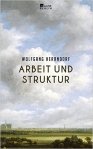
Wolfgang Herrndorf: Arbeit und Struktur (Rowohlt Berlin, Berlin 2013, 448 Seiten, € 19,95)
Momentan auf dem Nachttisch, im Bett, in der Bahn, in der Hängematte: Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf. Geht jetzt im letzten Drittel nicht mehr während der Zugfahrten, zu mitnehmend. Würde ich ein zweites Mal lesen, allein schon wegen der vielen Literaturempfehlungen, die es zu überprüfen gilt. Sehen wir mal in ein paar Jahren.
Momentan unterm Nachttisch in der Warteschlange: ein recht neuer Vargas, ein Nesser, von dem ich nicht weiß, was ich davon halten soll, Hustvedts Das Leiden eines Amerikaners und noch zwei oder drei Titel, an die ich mich gerade nicht erinnern kann. Außerdem steht noch einiges ungelesen im Bücherregal, darunter Attacken auf und Nachbetrachtungen über Hitlers willige Vollstrecker von Goldhagen sowie die Briefe an ihn, will ich unbedingt seit langem lesen.
Mit Herrndorf durch und durch. Großartig. Wie man während der Lektüre mit ihm hofft, obwohl man das Ende kennt. Gehört auf die Liste der Bücher, die man umarmen möchte.
Eintrag Herrndorfs vom 3. Oktober 2011:
Lese meine eigenen Dialoge und stelle fest, daß ich das Mißverständnis für das Wesen der Kommunikation halte. Es werden Fehler gemacht, und die Fehler führen zu allem. Man könnte auch Zufälle sagen, aber das Wort Fehler ist mir lieber. Ich halte den Roman für den Aufbewahrungsort des Falschen. Richtige Theorien gehören in die Wissenschaft, im Roman ist Wahrheit lächerlich. Das Unglück, die neurotische Persönlichkeit, das falsche Weltbild, das falsche Leben. Das richtige Leben, das in den Abgrund führt. Das Böse. Die Zeit.
30.9.2016.

Danach Håkan Nesser: Elf Tage in Berlin (btb, Berlin 2015, 384 Seiten, € 18,00). Herr Nesser sollte lieber bei Krimis bleiben. Flache Handlung, flache Charaktere, erweckt mehr den Anschein eines Jugendbuchs. Zudem irgendwie uninspirierte Sprache, fällt im Vergleich mit Herrndorf ab. Doppel- und Wiedergänger konnte E.T.A. Hoffmann deutlich besser und intensiver auf weniger Seiten.

Saša Stanišić: Wie der Soldat das Grammofon repariert (Luchterhand, München 2006, 320 Seiten, € 19,99)
Noch vor Herrndorf, immer noch im Kopf: Stanišić. Toller Autor, unbedingt mehr davon. Kommt vielleicht einmal in drei Jahren vor, dass ich bei einem Buch von der ersten Seite an weiß, dass es mir gefallen wird. Das ist sie:
Opa Slavko maß meinen Kopf mit Omas Wäschestrick aus, ich bekam einen Zauberhut, einen spitzen Zauberhut aus Kartonpapier, und Opa Slavko sagte: eigentlich bin ich noch zu jung für so einen Quatsch und du schon zu alt.
Ich bekam einen Zauberhut mit gelben und blauen Sternen, sie zogen gelbe und blaue Schweife, dazu schnippelte ich eine kleine Mondsichel und zwei Dreiecksraketen aus, eine flog Gagarin, die andere Opa Slavko.
Opa, mit dem Hut lasse ich mich nirgendwo blicken!
Das will ich hoffen!
Am Morgen des Tages, an dessen Abend er starb, schnitzte mir Opa Slavko aus einem Ast den Zauberstab und sagte: im Hut und im Stab steckt eine Zauberkraft, trägst du den Hut und schwingst du den Stab, wirst du der mächtigste Fähigkeitenzauberer der blockfreien Staaten sein. Vieles wirst du revolutionieren können, solange es mit den Ideen von Tito konform geht und in Übereinstimmung mit den Statuten des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens steht.
Ich zweifelte an der Zauberei, aber ich hatte keine Zweifel an meinem Opa. Die wertvollste Gabe ist die Erfindung, der größte Reichtum die Fantasie. Merk dir das, Aleksandar, sagte Opa ernst, als er mir den Hut aufsetzte, merk dir das und denk dir die Welt schöner aus. Er übergab mir den Stab. Ich zweifelte an nichts mehr.
Hätte ich womöglich nicht gelesen, wenn ich vorher gewusst hätte, mit wie vielen Preisen der Mann bereits überhäuft worden ist. Ihm ist zu wünschen, dass er niemals den Literaturnobelpreis erhalten möge, und wenn doch, dass er so klug ist, und ihn ablehnt (dennoch unrealistisch), wer will schon in einem Verein mit G. Grass sein? Will jetzt dringend mein Wissen über Jugoslawien aufbessern.

Nächstes: Siri Hustvedt: Die Leiden eines Amerikaners (Rowohlt, Reinbek 2008, 416 Seiten, antiquarisch). Noch nie was von ihr gelesen, von Rowohlt damals nach dem Bewerbungsgespräch Was ich liebte bekommen (hätt ich doch was von Tucholsky verlangt!), aber ungelesen weiterverschenkt. Die Leiden: Über die ersten 30 Seiten nicht hinausgekommen. Falsches Buch zur falschen Zeit möglicherweise, vielleicht auch einfach schlecht.

Orhan Pamuk: Diese Fremdheit in mir (Carl Hanser, München 2016, 592 Seiten, € 26,-)
Hm. Mit diesem Autor werde ich nicht warm. Beim Museum der Unschuld war es schon dasselbe: Interessante bis faszinierende Geschichte, aber zu lang und zu breit, die sich quälend langsam entwickelt und auf der Hälfte des Papiers mehr Anziehungskraft hätte. Und, tragisch wie traurig, ein weiteres schlecht lektoriertes Buch. Liebe Verlage, spart doch, wo ihr wollt (an Werbeanzeigen in der Postille „Zeit“ zum Beispiel), aber bitte, bitte nicht am Lektorat. Es ist höchst betrüblich, gute Literatur in schlechter Verfassung lesen zu müssen.
6.10.2016

Next one: Saša Stanišić again: Vor dem Fest (Luchterhand, München 2014, 320 Seiten, € 19,99). Kein sofortiger Sog wie beim Erstling, aber zwischendrin bereits aufblitzende Sätze, Satzfragmente, und Versatzstücke, die man sich merken will.
Gewissheit, keine Bücher mehr lesen zu wollen, die mich nicht innerhalb des ersten Zehntels begeistern. Wenn nicht, dann weg. Wenn einem im Schnitt 15.000 Lesetage (laut Arno Schmidt) zur Verfügung stehen und man in einem durchschnittlichen Vielleserleben etwa 5.000 Bücher schaffen kann, dann sollte die Auswahl mit Bedacht vorgenommen werden. Nichts für später aufsparen, was man auch exakt jetzt lesen könnte, sich nicht mit Worten herumschlagen, die einem nichts geben. Vielleicht tun sie’s später oder nie.
Herrlich absurde Szenen bei Stanišić – wie man mit einem himmelblauen 350-PS-Häcksler einen Zigarettenautomaten rammt; und ein Gemälde mit dem Titel „Der Neonazi schläft“. Großartig.
9.10.2016

Vor ein paar Wochen zur Aufheiterung gekauft und weil es in der Bücherei ständig ausgeliehen ist: Joachim Meyerhoff: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (KiWi, 22. Auflage (wow!), Köln 2016, 352 Seiten, € 9,99).
Logische Konsequenz, nach Alle Toten fliegen hoch. Amerika nun auch den zweiten Teil der Reihe zu lesen. Lohnt sich allein schon wegen der komisch-grotesken Beschreibung der Weihnachtsfeierlichkeiten in der Psychiatrie. Josef in Handschellen und Maria in Zwangsjacke keine Seltenheit, herrlich absurd. Und Protagonist Joachim, der seinen Vater, den Anstaltschef, beim festlichen Rundgang durch die Stationen begleiten darf und überall Cola trinken und Kuchen essen muss: „Eigentlich habe ich jedes Weihnachten gekotzt und dann die ganze Nacht von der Cola aufgeputscht mit bummerndem Herzen bis in die Morgenstunden manisch Legosteine zusammengebaut.“
12.10.2016

Jonathan Franzen: Das Kraus-Projekt (Rowohlt, Reinbek 2016, 304 Seiten, € 9,99)
Jonathan Franzen. Ich liebe Jonathan Franzen. Dumm nur, dass er zum Schreiben seiner Wälzer wesentlich länger braucht als ich zum Lesen. Nun also etwas ganz anderes – schmal, handlich, kraus-lastig. Die Anmerkungen Franzens laut Ankündigung länger als die Kraus-Texte, durchaus zutreffend. Noch nicht durch, Kraus braucht seine Zeit und die sollte man sich und ihm gönnen.
14.10.2016

Don DeLillo: Weißes Rauschen (Kiepenheuer & Witsch, Köln 1987, 448 Seiten, € 19,90)
Eine Herrndorf-Empfehlung. Beginnt sehr großartig, fällt aber nach der Hälfte ab, dann nur noch eine Anhäufung von langatmigen Befindlichkeiten. Man wartet auf ein Ergebnis, eine Auflösung, irgendwas. Aber da kommt nichts. Dennoch, der Anfang lohnt! Allein schon wegen der Breitseiten gegen das Deutsche mit Sätzen wie „Die deutsche Sprache. Fleischig, verschroben, spuckesprühend mit einem Stich ins Violette gehend und grausam.“ oder „Mein persönlicher regelmäßiger Freitagsbrauch war es, mich nach einem Abend vor dem Fernseher bis tief in die Nacht bei Hitler festzulesen.“ So einen Brauch möchte ich auch.
16.10.2016

Mark Twain: Die Abenteuer des Huckleberry Finn (Dressler, Hamburg 1995, 464 Seiten, antiquarisch, ab 10 Jahren)
Noch mal Herrndorf.
Aus der Verlagswerbung zur Übersetzung:
Mit der Neuübersetzung von Wolf Harranth legt der Cecilie Dressler Verlag erstmals eine deutsche Ausgabe vor, in der die verschiedenen Dialektschattierungen des Originals treffend wiedergegeben werden.
No way. Liest sich gewollt und verkrampft. Dialekt zu übersetzen halte ich prinzipiell für eine ehrenvolle Sache, die aber meistens nicht funktioniert. Nach Recherche über verschiedene Übersetzungsstrategien in bezug auf Huckleberry Finn/Tom Sawyer werde ich es demnächst mit der gelobten Neuübersetzung (Hanser 2010) von Andreas Nohl versuchen. Vielleicht kommt auch das Hörbuch auf Grundlage dieser Übersetzung in Frage, die Hörprobe klingt vielversprechend.
17.10.2016

Senek Rosenblum: Der Junge im Schrank. Eine Kindheit im Krieg (btb, München 2010, 432 Seiten, antiquarisch)
Dieses Buch stand nun ungefähr ein Jahr in meinem Bücherregal. Habe ich mal im Antiquariat entdeckt. Eine Geschichte über Flucht, Überleben unter den denkbar unmenschlichsten Umständen und eine nie ganz versiegende Hoffnung, dass es irgendwann ein Leben ohne die tagtägliche Angst vor Vernichtung geben kann. Und das alles mit dem Blick eines sieben-, achtjährigen Kindes. Senek Rosenblums Kindheit endet Anfang der 40er Jahre. Man leidet mit ihm, wenn geliebte Menschen verschwinden, man leidet mit ihm bei der Ankunft im Warschauer Ghetto, man leidet mit ihm während der einjährigen Periode des Verstecktseins im Kleiderschrank eines jungen polnischen Paares, man leidet mit ihm, wenn der Vater, der all das organisiert, wieder für Monate verschwindet, man leidet mit ihm, als endlich die Russen kommen, die gegen Hunger und Kälte aber selbst nicht viel aufzubieten haben.
Es ist gut, dass Senek Rosenblum sein Martyrium aufgeschrieben hat. Es ist gut, dass er auch seine Rachegedanken gegenüber seinen zahlreichen Peinigern artikuliert, auch wenn er nie Gelegenheit hatte, sie in die Tat umzusetzen.
Der Tag, an dem sein Vater ihn nicht wieder allein lässt: „An diesem wolkenverhangenen und kalten Tag wandle ich auf der Sonnenseite des Lebens.“
18.10.2016

Jonathan Franzen: Unschuld (Rowohlt, Reinbek 2015, 832 Seiten, € 26,95)
Nicht als Zuglektüre geeignet, da gefühlt zwei Kilo schwer. Parallel dazu Rosenblum gelesen. Franzen dauert entsprechend länger.
Großartig, wie fast immer. Nicht so gut wie Die Korrekturen, aber gut, sehr gut.
30.10.2016

Charles M. Schulz: Die Peanuts. Werkausgabe. Band 20, 1989 bis 1990 (Carlsen, Hamburg 2016, 344 Seiten, € 32,90)
Altersempfehlung des Verlags: 14 bis 17 Jahre. Witzig. Ich würde sagen: Wer lesen kann, der lese die Geschichten von den kleinen Philosophen und ihren großen Problemen, auch wenn man vielleicht nicht jede politische oder baseball-basierte Anspielung versteht (hierbei hilft außerdem das ausführliche Glossar). In jedem steckt ein Charlie Brown, eine Lucy van Pelt, und mit etwas Glück vielleicht sogar etwas vom besten aller Hunde.
31.10.2016

Irvin D. Yalom: Denn alles ist vergänglich. Geschichten aus der Psychotherapie (btb, München 2015, 240 Seiten, € 19,99)
Yalom kann ich immer wieder lesen. Wirklich. Dieses muss ich laut Kalenderaufzeichnung tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr gelesen haben, November 2015, damals jeden Abend nur eine Geschichte, um es nicht einfach nur zu konsumieren. Das werde ich jetzt wieder so handhaben. Großartige Einblicke in die menschliche Psyche. Immer wieder faszinierend, wie Yalom seinen Patienten in mitunter nur zwei, drei Sitzungen nahe kommt und zum Teil erstaunliche Anstöße gibt, wie er hilft Blockaden zu lösen. Sowohl seine Romane als auch die Geschichten aus der Psychotherapie haben mich fasziniert – und mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen. Danke, Mr. Yalom.
Das war also der Oktober. Mal sehen, was der November außer Depression zu bieten hat.
Und weil man Literatur nicht nur lesen, sondern sogar sehen kann, hier meine Entdeckung des Monats – für alle Deutsch-LKler, Germanizisten und sonstigen Freunde des geschriebenen Wortes: Der Dramaturg Michael Sommer bringt mit seiner Literatur to go Stimmung in den Kanon. Großes Kino! (Über drei Ecken via W. Herrndorf entdeckt. Ja, der schon wieder!)
Zum Beispiel: Buddenbrooks in neuneinhalb Minuten:
